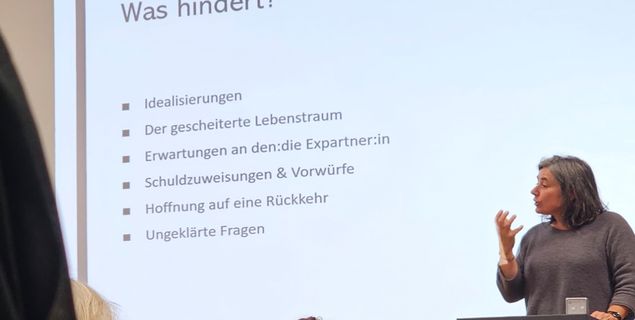Seit einem Velounfall mit 12 Jahren lebt Dora mit einer Zerebralparese. Als Frau mit einer Behinderung war sie Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt. Teil 1 unserer dreiteiligen Mini-Serie «Mein Leben als Frau mit Behinderung in den 70er Jahren».
Im Januar 1972 erwachte ich als 12-jähriges Mädchen nach dreiwöchiger Bewusstlosigkeit mit verkrampftem Körper in einem Bett im Basler Kinderspital. Mein Geist funktionierte, alles andere war weg. Ich konnte nicht mehr sprechen, fühlte mich hilflos. Meine Eltern, die Ärzte, das Pflegepersonal und die Therapeut:innen erklärten mir, was passiert war: Am 13.12.1971 verunglückte ich auf dem Schulweg mit dem Velo schwer und habe ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Als Folge blieb eine zerebrale Lähmung in der linken Körperhälfte. Ich müsse nun alles wieder von neuem lernen. Festplatte gelöscht – neu formatieren. Die Ärzte sagten mir ein Leben im Rollstuhl voraus, allenfalls würde ich eine Arbeit in einer geschützten Werkstätte ausüben können.
Ich lernte im Spital zwar dank Physiotherapie bald wieder gehen und meinen Körper zu gebrauchen. Mit der Ergo-Therapeutin übte ich die alltäglichen Verrichtungen und die Sprachtherapeutin half mir, mich besser zu artikulieren. Jedoch war die spastische Lähmung offensichtlich, die Koordination der beiden Seiten meines Körpers gestaltete sich schwierig.
«Ich war ein Mädchen am Anfang der Pubertät auf dem Weg zur Frau, schwärmte für Peter Maffay oder die Bay City Rollers.»
Trotzdem wollte ich so bald als möglich das Spital verlassen, zurückkommen in mein früheres Leben. Als junges Mädchen sehnte ich mich nach meinen Schulkameradinnen und meinem heimlichen Schulschatz. In meiner Naivität hoffte ich, mein Leben würde weitergehen wie vor meinem Unfall. Nach der Entlassung aus dem Spital im April 1972 taten meine Eltern und die Lehrer:innen alles, damit ich meine Schulbildung nahtlos fortsetzen konnte.
Zielscheibe des Spotts oder Mitleids
Dank intensiven ambulanten Therapien und meinem Durchhaltewillen machte ich körperlich Fortschritte und in der Schule kam ich gut mit. Meine Eltern und Verwandten standen zum Glück vorbehaltlos hinter mir. Ich denke zum Beispiel mit Stolz an meinen Vater, der schon mal drängelnde Passagiere zusammenstauchte, weil sie mich nicht zuerst über die hohen Stufen in den Zug einsteigen lassen wollten. Meine Mutter bezog mich auch in die allgemeinen Hausarbeiten mit ein, wofür ich ihr noch heute sehr dankbar bin.
Der Übergang vom geschützten Rahmen des Spitals ins Leben hinaus war jedoch in jeder Hinsicht ein Riesenschock.
Zur Person
| Dora Bigler, 66, lebt seit sie 12 Jahre alt ist mit Zerebralparese. Sie war alleinerziehende Mutter und arbeitete unter anderem als Übersetzerin und Chefsekretärin. Heute ist sie pensioniert und lebt im Kanton Bern. |
Im Spital hatten mich alle ermutigt und jeden meiner Fortschritte gefeiert. Draussen war ich nur noch Zielscheibe des Spotts oder des Mitleids. Ich fühlte mich überall fremd, auch in meiner bisherigen Schulklasse. Meine Kolleginnen sonnten sich in ihren Erfolgen beim andern Geschlecht, schwärmten von ihrem Schatz, ihrem ersten Kuss. Da konnte ich nicht mithalten, die Gleichaltrigen hatten nur Verachtung für ein Mädchen wie mich übrig. Und doch wollte ich dazugehören, wollte wie meine Kameradinnen Verliebtheit und Liebe erleben. Ich war ein Mädchen am Anfang der Pubertät auf dem Weg zur Frau, schwärmte für Peter Maffay oder die Bay City Rollers.

Um meine Ausgangslage aus heutiger Sicht besser zu verstehen, muss man sich auch die Stellung der Frau in den Siebzigerjahren vor Augen halten. Sie definierte sich zu jener Zeit ausschliesslich über ihren Mann. Erst wenn eine Frau ihre «bessere Hälfte» gefunden hatte, fühlte sie sich vollständig. Unverheiratet mit einem Mann zusammenzuleben, also in «wilder Ehe», kam in der damaligen Zeit überhaupt nicht in Frage.
Behinderungen verstecken und negieren
Schon von klein auf spürte ich deutlich, dass in der Gesellschaft nur die verheirateten Frauen (und Mütter) als richtige Frauen betrachtet wurden. Man sah auf die ledigen «Fräuleins» herab, die sich ihren Lebensunterhalt selber verdienen mussten und dabei doch auf keinen grünen Zweig kamen. Geschiedene Frauen, vor allem die Mütter, standen erst recht auf verlorenem Posten.
Der Kampf für die Rechte der Frauen und ihre beruflichen Chancen steckte damals noch in den Kinderschuhen, das Frauenstimmrecht war in der Schweiz ja erst 1971 eingeführt worden.
«Das Wort «Inklusion» kannte man damals gar nicht, das Wort «Behinderte» wurde als gängiges Schimpfwort verwendet. »
Was waren also meine beruflichen und persönlichen Perspektiven als Frau mit körperlicher Behinderung?
1972 glich die Eingliederung von Behinderten einem Kraftakt, von gesellschaftlicher Seite war kein Entgegenkommen zu erwarten. Familien mit einem behinderten Kind wurden in dieser Situation allein gelassen, meistens kamen die Geschwister zu kurz. Das Wort «Inklusion» kannte man damals gar nicht, das Wort „Behinderte“ wurde als gängiges Schimpfwort verwendet. Betroffene mussten zuerst beweisen, dass sie sich in der sogenannt normalen Welt zurechtfinden – und dafür mussten sie die Behinderung negieren und verstecken. Es galt aber auch, sich von anderen Behinderten abzugrenzen und seinen Platz in der Welt der «Normalos» zu verteidigen. Auf dieser «Hierarchie» standen beispielsweise die Menschen mit Trisomie21 (damals noch diskriminierend als „Mongoloiden“ bezeichnet) ganz weit unten.
Jegliche Bedürfnisse abgesprochen
Die zahlreichen architektonischen Hindernisse würden wohl im Jahr 2026 Riesenproteste auslösen, damals galt eine solche Bauweise als normal: Um in Trams, Busse oder Züge zu gelangen, musste man musste hohe Stufen überwinden, der Zugang zu Bahnhöfen und auf Bahnsteige führte über endlos lange Treppen. Die öffentlichen Toiletten mit ihren schmalen und schweren Türen befanden sich oft im Untergeschoss und waren nur über steile Treppen zu erreichen. Hilfsbereitschaft erlebte ich damals als seltene Tugend. Im Gegensatz zu heute: Besonders junge Leute bieten mir in überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln ganz selbstverständlich ihren Platz an oder helfen mir mit dem Einkaufswagen über eine steile Stufe.
Die baulichen Hürden waren aber nur ein Teil des Problems. Viel mehr ins Gewicht fiel die Tatsache, dass Behinderte als anspruchslose und asexuelle Wesen angesehen wurden. Niemand konnte sich vorstellen, dass eine behinderte Person nicht nur dazugehören wollte, sondern auch das Bedürfnis nach Liebe, einer Beziehung und Sex hatte.
Meine Eltern spürten natürlich, wie isoliert ich war. Sie meinten, ich solle mich lieber auf meine Ausbildung und vor allem auf meine intellektuellen Fähigkeiten konzentrieren. Insgeheim dachten sie wohl auch, dass ich einmal ein «lediges Fräulein» bleiben würde.
Aber ich wollte nicht in eine Ecke abgeschoben werden. Die Zeit der Siebzigerjahre bis zum Ende meiner Mittelschulausbildung war für mich vor allem von einem Wunsch geprägt: Ich wollte sowohl beruflich wie auch als Frau ein erfülltes und in jeder Hinsicht unabhängiges Leben führen können.
Dieses Ziel habe ich auch später nie aus den Augen verloren.
Bald bei rob.ch: Teil 2 von «Mein Leben als Frau mit Behinderung in den 70er Jahren»